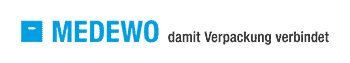Egal ob im Beruf oder in der Freizeit – Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden stehen immer an erster Stelle. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist dabei ein unverzichtbarer Bestandteil, um Sie vor Verletzungen und gesundheitlichen Risiken zu schützen. Erfahren Sie, worauf es bei persönlicher Schutzausrüstung wie Handschuhen, Gehörschutz, Schutzbrillen & Co. ankommt.
Um die PSA-Ausrüstung zu kategorisieren, werden diese in 3 verschiedene PSA-Kategorien aufgeteilt:
Kategorie I: Schutz vor geringfügigen Risiken (etwa Witterung oder Staub)
Kategorie II: Schutz vor mittleren Risiken (etwa Verletzungen, bei denen ärztliche Hilfe nötig ist)
Kategorie III: Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken für Leib und Leben (etwa Chemikalien)
Dabei zählen die Handschuhe, Schutzbrillen und Gehörschutzlösungen zur Kategorie II
Handschuhe
Gehörschutz
Schutzbrillen / Gesichtsschutz
Atemschutz
Handschuhe

Ob in der Logistik, bei Montagearbeiten oder in der Fertigung: Hände benötigen bei einer Vielzahl von Tätigkeiten ausreichenden Schutz. Deshalb bieten Handschuhe einen wichtigen Bestandteil der Schutzausrüstung.
Damit die Handschuhe auch vor Arbeitsverletzungen schützen können, ist eine entsprechende Prüfung und Zertifizierung notwendig. Dies wird mittels der sogenannten DIN EN 388 und EN 420 festgestellt.
Die DIN-Tests gegen Aufschluss darüber, wie leistungsfähig ein Handschuh ist.
Nach folgenden mechanischen Kriterien werden die Textilien geprüft:
- Abriebfestigkeit – mit Hilfe eines Schleifpapiers
- Schnittfestigkeit – bisher nur mit Hilfe eines rotierenden Kreismessers (genannt Coupe-Test), nun in einem zweiten Test mit einer langen geraden Klinge
- Weiterreissfestigkeit – durch Krafteinwirkung auf einen eingeschnittenen Handschuh
- Durchstichfestigkeit – mit Hilfe eines Nagels
Handschuhe mit Schnittschutz

Gerade bei Handschuhen wo der Schnittschutz eine wichtige Rolle spielt, wir ein zusätzlicher Test unter EN ISO 13997 durchgeführt. Sie liefert gerade bei einem hohen Schnittschutzlevel noch genauere Ergebnisse, die mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet sind.
Handschuhe mit Hygieneschutz

Für feinere Arbeiten an elektronischen Bauteilen oder auch bei Anwendungen, wo die Hygienevorschriften hoch zu werten sind, ist ebenfalls der eigene Schutz äußerst wichtig. Der Anwendungsbereich ist hier sehr breit und reicht von der Montage, in die Reinigung bis hin zu medizinischen Einrichtungen oder in die Gastronomie.
Gehörschutz
Ein Gehörschutz blendet Lärmquellen aus und schwächt sie ab – eine wichtige Voraussetzung für Arbeiten in lauten Umgebungen. Schliesslich gibt es im Sinne des Gesundheitsschutzes genaue Regelungen, für welche maximale Zeitspanne Angestellte welchem Dezibel-Pegel ausgesetzt sein dürfen. Senken Sie mit dem richtigen Gehörschutz den Schallpegel, kann der Mitarbeiter sich auch länger an lauten Orten aufhalten.

Ob Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel – in der Norm DIN EN 352 ist genau festgelegt, welche sicherheitstechnischen Anforderungen im Rahmen von Arbeitsschutzbekleidung erfüllt sein müssen, etwa zur Konstruktion, Leistung und Kennzeichnung.
Neben der Zertifizierung nach der genannten Norm ist bei der Wahl des passenden Gehörschutzes der Wert SNR (Abkürzung für Single Number Rating) wichtig. Er beschreibt den Dämmwert und somit die Dezibel, um die der Schallpegel reduziert wird. Auch in welchem Frequenzbereichen der Schutz wirkt, ist entscheidend. Je nach Art der Ausrüstung reduziert der Schutz die Dezibel im Bereich Hochfrequenz, Mittelfrequenz oder Tieffrequenz (H/M/L) unterschiedlich.

Der Kapselgehörschutz Plus ist ein hochwertiger Ohrenschützer, der von aussen auf die Ohrmuscheln aufgesetzt wird.
Die besonders weichen Kapseln und der gepolsterte Kopfbügel sorgen für einen hohen Tragekomfort.
Die stufenlose Längenverstellung bewirkt einen angenehmen Sitz an jedem Kopf.
Damit eignet er sich optimal zur regelmässigen Nutzung, um eine Lautstärke um 32 Dezibel zu dämmen.

Die Gehörschutzstöpsel sind eine ideale Einweg-Lösung für den Arbeitsschutz.
Sie werden in den Gehörgang eingeführt und schützen das Gehör von innen.
Für Mitarbeiter, die nicht regelmässig in einem lauten Bereich arbeiten, sind Einweg-Gehörschutzstöpsel eine günstige und hygienische Alternative.
Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche und das hautfreundliche Material Polyurethan sorgen für eine sichere und hygienische Nutzung.
Das weiche Material lässt sich sehr gut verformen und dehnt sich im Ohr wieder aus, sodass die Stöpsel angenehm und sicher sitzen.
Sie dämmen die Lautstärke um 37 Dezibel.

Auch das Gesicht und insbesondere die Augen wollen geschützt sein. Schutzbrillen halten je nach Konstruktion herumfliegende Partikel wie Staub und Späne oder auch Flüssigkeitsspritzer fern. Damit dies gewährleistet wird, beschreibt die DIN EN 166 die grundsätzlichen Anforderungen an diese Art von persönlicher Schutzausrüstung, sei es die Kennzeichnung oder die Voraussetzungen, um die nötige Schutzwirkung zu erzielen. Ein fester Bestandteil der Prüfung der Brillen ist das Verhalten bei mechanischen Einwirkungen.
Um diese mechanische Festigkeit festzulegen, werden die Sichtscheiben mit einer Stahlkugel beschossen. Je nachdem, welcher Aufprallgeschwindigkeit die Brille standhält, erhält der Augenschutz eine der folgenden Kennzeichnungen. Diese findet sich auch als Aufdruck darauf:
S: erhöhte mechanische Festigkeit (Falltest – Aufprallgeschwindigkeit von 5,1 m/s)
F: Stoss mit geringer Energie (Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s)
B: Stoss mit mittlerer Energie (Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s)
A: Stoss mit hoher Energie (Aufprallgeschwindigkeit von 190 m/s)
Je nach Art der Brille (Bügelbrille oder Vollsichtbrille) sind die möglichen Maximalwerte unterschiedlich. So liegt diese bei einer Bügelbrille in der Kennzeichnung F, bei einer Vollsichtbrille in der Kennzeichnung B. Zusätzlich kann die Brille auch vor ultravioletter oder UV-Strahlung schützen. Details dazu sind in der DIN EN 170 sowie 171 festgelegt.
Diese hochwertige, elastische Bügelbrille im sportlichen Design bietet idealen Augenschutz bei herumfliegenden Partikeln und Teilchen wie Staub, Spänen und Splittern. Die reflektierenden, gewölbten Sichtscheiben gewährleisten guten Augen- und Blendschutz sowie perfekte Farbwahrnehmung nach allen Seiten. Die Schutzbrille garantiert ausserdem uneingeschränkte Rundumsicht. Sie ist durch eine Gummierung des Nasenstegs, der elastischen Bügel und des Stirnbereichs besonders angenehm zu tragen. Der sichere Sitz ist ideal für den längeren Einsatz.
Bei Schutzmasken muss grundsätzlich zwischen Mund- und Atemschutz unterschieden werden. Die frühere Bezeichnung von Mundschutz, «Grobstaubmaske», deutet bereits an, warum. Eine Mundschutzmaske hält Flüssigkeitströpfchen oder grobe Partikel ab, die nicht in die Lunge vordringen würden. Gerade in hygienisch sensiblen Bereichen – wie etwa Arztpraxen oder der Lebensmittelindustrie – kommt ein solcher Mund-Nasen-Schutz zum Einsatz.

Dabei legt die europäischen Norm 14683 verschiedene Typen fest, die sich in ihrer Filterleistung und dem Atemwiderstand unterscheiden. Je höher dabei die Filterleistung und desto geringer der Atemwiderstand, umso besser der Schutz bzw. der Komfort beim Tragen.
Im Gegensatz dazu filtert ein Atemschutz die Luft und mindert Gefahren von beispielsweise Feinstaub-Partikeln, die ohne das Tragen der Maske in die Lunge gelangen können.
Filtrierende Halbmasken werden dabei nach der EN 149 zertifiziert und nach deren Vorgaben gekennzeichnet. So zählen die Masken zu einer von drei Schutzklassen, genannt FFP (filtering face piece). Während FFP 1 vor ungiftigen Stäuben schützt, beugt FFP 2 gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen vor. Die höchste Sicherheit bietet FFP 3, nämlich vor giftigen Stäuben.
Zusätzlich gibt die Kennzeichnung Auskunft darüber, ob die Maske mehrmals – nach Desinfektion – getragen werden kann («R» – reusable) oder für den einmaligen Gebrauch («NR» – not reusable)
gedacht ist. Der Buchstabe «D» zeigt darüber hinaus an, dass die Maske die sogenannte Dolomitstaubprüfung bestanden hat. Hier wird die Qualität bestätigt, dass die Ausrüstung auch nach längerem Einsatz noch einen geringen Atemwiderstand und die benötigte Filterleistung bietet.
Atemschutzmaske ohne Ventil

- 5-lagig
- Einweg (bis max. 8 Stunden)
- Schutz gegen Aerosole, Tröpfchen, Rauch und Staub
- Bequeme, runde Passform
- weiches, hautfreundliches High-Tech-Vlies
- mit anpassbarem Nasenbügel
- elastische Ohrenschlaufen
Atemschutzmaske mit Ventil

- 3-schichtig
- Einweg
- Schutz für Nase und Mund gegen Staub, feine Partikel, Tröpfchen, Aerosole, Gerüche
- Bequeme, runde Passform
- Weiches, hautfreundliches Schaumstoffpolster für einen angenehmen Sitz im Nasenbereich
- Flexibles, latexfreies Gummiband
- Ausatemventil reduziert Feuchtigkeit und Wärme in der Maske